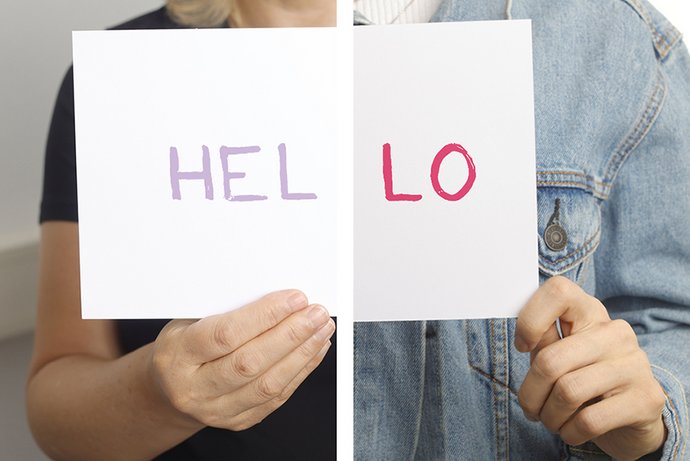Sila verließ 2005 ihre Heimat. Sie floh gemeinsam mit ihrem Sohn aus der Türkei, weil sie dort nicht mehr sicher war und Traumatisches erleben musste. Seitdem lebt sie in Deutschland. Hier scheint sich ihr Leben zu stabilisieren: Sie findet Arbeit, heiratet und lernt Deutsch. Doch die Sicherheit, die sie sich aufbaut, trügt. Ihre Vergangenheit lässt sie nie ganz los. Die Erinnerungen verfolgen sie und die erlebten Traumata kreisen unaufhörlich in ihrem Kopf. Sila spürt, dass sie Hilfe braucht, doch sie hat Angst, nicht verstanden zu werden. Ihre Gefühle sind überwältigend, aber die Worte dafür fehlen ihr. Wie soll sie in einer fremden Sprache ausdrücken, was sie selbst nicht richtig versteht?
Wachsender Bedarf
Sila ist damit nicht allein. Tausende Menschen in Deutschland teilen ihre Erfahrungen. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte zögern – wie Sila – psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Suche nach einem Therapieplatz in ihrer Muttersprache bleibt oft erfolglos. In einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen eine Migrationsgeschichte haben, steigt der Bedarf an kultursensibler und muttersprachlicher Versorgung stetig.
Zugleich erhalten Menschen mit Migrationsgeschichte oftmals keine gleichwertige medizinische Versorgung. Die Ursachen sind vielfältig: mangelnde interkulturelle Öffnung von medizinischen Institutionen, Sprach- und Verständnisprobleme, Vorurteile auf beiden Seiten, erlebte Diskriminierung.
Barrieren überwinden
Am ZI wurde nach einer Lösung für dieses Problem gesucht: 2023 gründete das Team um Dr. Suna Su Aksay das Transkulturelle Zentrum. Hiermit möchten sie Menschen mit Migrationsgeschichte gleichberechtigt in die Versorgungsstrukturen einbinden und interkulturelle Belange in allen Bereichen des ZI berücksichtigen.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Vorhabens ist die Einführung einer neuen Versorgungseinheit: der Transkulturellen Ambulanz. Sie bietet ambulante Diagnostik und Behandlung für Menschen mit Migrationsgeschichte, einschließlich Geflüchteter, in deren Muttersprachen. Das Angebot reicht von offenen Sprechstunden und Pharmakotherapie über Psychotherapie und Konsile für stationäre Patientinnen und Patienten bis hin zur klinikübergreifenden Zusammenarbeit.
Auf Bedürfnisse eingehen
Der Weg zur Gründung der Transkulturellen Ambulanz begann vor vielen Jahren mit dem Wunsch, die insbesondere in Mannheim große Gruppe türkischstämmiger Menschen besser zu erreichen. Anfangs war es das Engagement einzelner Behandlerinnen und Behandler, das den Anstoß gab. 2020 wurde die Psychiatrische Ambulanz durch eine türkischsprachige Sprechstunde erweitert, um gezielt auf die Bedürfnisse einzugehen.
Doch auch die sich verändernde weltpolitische Lage machte neue Angebote erforderlich: 2015 entstand eine Geflüchtetenambulanz. In engem Austausch mit dem Leiter der Zentralambulanz am ZI, Dr. Oliver Hennig, wurde schnelle und koordinierte Hilfe für neu angekommene Menschen geboten. Parallel dazu führte die Kinder- und Jugendpsychiatrie eine wöchentliche Sprechstunde für Minderjährige mit Flucht- und Migrationshintergrund ein. Als der Krieg in der Ukraine 2022 begann, entstand innerhalb weniger Tage eine Sprechstunde für ukrainisch- und russischsprachige Geflüchtete.
Diese Schritte bereiteten den Weg für die Transkulturelle Ambulanz, die aus dem kontinuierlichen Austausch, der Motivation und der Unterstützung der engagierten Teams hervorging. Damit werden die bestehenden Initiativen nun zentral koordiniert und das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Heute finden Sprechstunden auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch statt. Zusätzlich helfen (Telefon-)Dolmetscher bei anderen Sprachen, sodass Verständigungsprobleme überwunden werden können.
„Ich fühlte mich endlich verstanden“
Auch Sila fand einen Therapieplatz in der Transkulturellen Ambulanz. „Das war ein echter Wendepunkt für mich“, erzählt sie. Nach langen Jahren der Unsicherheit und Sprachbarrieren fand sie endlich die Möglichkeit, ihre Gefühle klar zu benennen und ihre Erlebnisse zu teilen. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in Deutschland konnte sie ihre inneren Zustände in ihrer Muttersprache beschreiben und in einen echten Austausch treten. Durch ihre Erfahrungen in der Transkulturellen Ambulanz verstand Sila ihre Diagnose und konnte ihre Gefühle besser einordnen. Die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache zu sprechen, gab ihr ein neues Maß an Klarheit und Selbstbewusstsein. „Ich fühlte mich endlich verstanden“, sagt Sila.
„Die Psychiatrie ist eine sprechende Medizin. Psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung kann nur durch gegenseitiges Verstehen gelingen. Sprache ist dabei unser wichtigstes Werkzeug und essenziell für die Diagnostik, eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung und die Anwendung unterschiedlicher Therapiemethoden“, erklärt Suna Su Aksay, Oberärztin und Leiterin des Transkulturellen Zentrums. Kommunikation und Austausch ermöglichen Patientinnen und Patienten, ihre Gedanken und Gefühle zu strukturieren und zu reflektieren. Durch das Aussprechen und Diskutieren von Problemen sowie den verbalen Ausdruck von Emotionen können neue Einsichten und Perspektiven gewonnen werden. Diffuse emotionale Zustände werden dadurch besser greifbar und emotionaler Druck kann abgebaut werden. Sprachbarrieren zwischen Patienten und Behandelnden können diesen Prozess erschweren. Auch wenn Patienten Deutsch sprechen können, fehlt oft das Vokabular für innere Krisenzustände. In der eigenen Muttersprache fühlen sich Menschen sicherer und können intuitiver kommunizieren. „Psychiatrie oder Psychotherapie erfordern ein anderes Sprachniveau als beispielsweise ein Besuch beim Orthopäden. Unsere Patientinnen und Patienten haben zwar häufig grundlegende Deutschkenntnisse, mit denen sie im Alltag gut zurechtkommen, aber für eine Psychotherapie reicht das oft nicht“, erklärt Dr. Dimitri Hefter, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Vor ihrer Therapie in der Transkulturellen Ambulanz war Sila bereits in stationärer Behandlung. Sie erinnert sich daran als eine Zeit der akuten Krise. Die Behandlung half ihr zwar, sich zu stabilisieren, doch es fiel ihr sehr schwer, sich mit Behandlern und anderen Patienten auszutauschen. Nur einzelne Behandler sprachen ihre Sprache. Sie nahm an Therapien teil, in denen sie nur wenig verstand. Außerhalb der Therapiezeiten versuchte sie Inhalte und Materialien eigenständig zu übersetzen oder legte sich Sätze für die nächste Therapiestunde zurecht. „Ich fühlte mich unvollständig“, erinnert sie sich. Und so waren es häufig keine Worte, sondern kleine Gesten, ein Lächeln oder ein freundlicher Blick von Mitpatienten, die Sila Vertrauen und das Gefühl gaben, nicht allein zu sein.
Nach ihrer Entlassung suchte Sila lange nach türkischsprachigen niedergelassenen Ärztinnen oder Ärzten, bevor sie auf die Transkulturelle Ambulanz aufmerksam wurde. Doch das Angebot war gering und die Wartezeiten zu lang. Auch das ist kein Einzelfall, denn das Angebot an muttersprachlich-psychiatrischer Versorgung im niedergelassenen Bereich ist sehr begrenzt. Patienten warten häufig länger als 18 Monate auf einen Therapieplatz.
Kultursensible Behandlung
Doch Sprache allein reicht oft nicht aus, um in der Therapie eine echte Verbindung herzustellen. Diese Erfahrung machte auch Sila: Selbst bei Behandelnden, die ihre Muttersprache sprachen, fühlte sie sich oft missverstanden. Denn echtes Verstehen gelingt nicht durch Worte allein. Respektvoll mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen umzugehen und die jeweils individuelle Migrationsgeschichte einzubeziehensind wichtige Faktoren in der Therapie. Erst wenn diese Aspekte aktiv in die Behandlung einfließen, kann Verständigung auf einer tieferen Ebene gelingen.
In der Transkulturellen Ambulanz ist genau das ein entscheidender Faktor. Das Team setzt nicht nur auf sprachliche, sondern vor allem auf transkulturelle Kompetenzen. Kultursensible Behandlungsmethoden stehen hier im Mittelpunkt. „Was unser Team auszeichnet, ist zum einen unsere Offenheit für die kulturelle Identität unserer Patientinnen und Patienten, und zum anderen unsere Fähigkeit, Sprach- und Verständnisbarrieren zu überwinden“, erklärt Suna Su Aksay.
Katarina kam vor etwas mehr als zwei Jahren nach Deutschland. Vorher lebte sie in der Ukraine. Doch nach Beginn des Krieges war ihr Wohnort nicht mehr sicher. Bomben fielen und die Lage verschärfte sich. Mit ihrer Familie fand sie Schutz in Deutschland. Aber das Erlebte verfolgte sie auch hier. Sie entwickelte Schlafprobleme und Angstzustände. Durch eine Überweisung ihres Hausarztes fand sie den Weg zum ZI und wird nun seit einem Jahr in der Transkulturellen Ambulanz behandelt. Für Katarina ist es nicht in erster Linie die gemeinsame Sprache, sondern vielmehr das kulturelle Verständnis, das in ihrer Behandlung wichtig ist. Wenn sie mit ihrem ukrainischsprachigen Arzt redet, hat sie das Gefühl, auf einer tieferen Ebene verstanden zu werden: „Wenn ich mit ihm arbeite, habe ich das Gefühl, dass er mich versteht. Er kennt meine ukrainischen Realitäten. Ich fühle mich wohler und offener mit ihm.“
Patienten fühlen sich oft besser verstanden und weniger mit Vorurteilen konfrontiert, wenn ihre Behandler ähnliche kulturelle Hintergründe haben oder selbst Migrationserfahrungen mitbringen. „Wahrgenommene oder auch vermutete Gemeinsamkeiten führen zu einem Vertrauensvorschuss, den uns die Patientinnen und Patienten entgegenbringen. Dadurch öffnen sie sich schon im ersten Gespräch mehr und können sich leichter anvertrauen“, sagt Dimitri Hefter. „Entscheidend für die therapeutische Beziehung ist jedoch vor allem unsere kultursensible Arbeit", ergänzt Meryem Başak, Psychologische Psychotherapeutin im Team der Transkulturellen Ambulanz. Die Zusammenarbeit in diesem Rahmen funktioniert auf einem Niveau, das weit über reine Sprachkompetenz hinausgeht.
Ein wichtiger Aspekt kultursensibler Arbeit ist der offene Umgang mit Nichtwissen. Die Behandelnden möchten die persönlichen Einstellungen und die kulturelle Identität ihrer Patienten kennenlernen, um zu verstehen, wie diese die Wahrnehmung von Krankheit und die Behandlung beeinflussen können. Dies ist besonders wichtig, wenn Patienten bereits diskriminierende Erfahrungen im medizinischen Kontext gemacht haben. „Wir möchten, dass sich unsere Patientinnen und Patienten verstanden und respektiert fühlen. Hier stoßen sie nicht auf Vorurteile und müssen sich nicht rechtfertigen“, betont Meryem Başak.
Von den Patienten erfährt das Team viel Dankbarkeit und Wertschätzung. „Ich bin so froh, dass ich eine Therapie mache. Denn wenn ich das nicht täte, wüsste ich nicht, was jetzt mit mir los wäre. Am Anfang war ich am Boden zerstört. Aber jetzt versuche ich langsam, wieder zu funktionieren und mich besser zu fühlen. Ich bin so dankbar und glücklich darüber”, fasst Katarina zusammen.
Blick in die Zukunft
In der Transkulturellen Ambulanz sollen Menschen mit Migrationsgeschichte eine qualitativ hochwertige, leitliniengerechte Diagnostik und Behandlung erhalten. Weitere Ziele des Teams gehen über die Patientenversorgung hinaus und sollen die gesamte Struktur des ZI nachhaltig verändern. Dazu gehört die interkulturelle Öffnung des Instituts. Das bedeutet, dass Strukturen, Personal und Prozesse an die Bedürfnisse einer vielfältigen Bevölkerung angepasst werden. Ein Beispiel dafür ist die geplante Stärkung der kultur- und sprachkompetenten Versorgung auf allen Stationen. Auch Fortbildungen zum Thema Kultursensibilität und interkulturelle Kompetenz sind vorgesehen. Für Koordination und Leitung dieser Themen wird ab Herbst 2024 eine dem Vorstand zugeordnete Stelle am ZI etabliert.
Parallel zur interkulturellen Öffnung des ZI und der verbesserten Versorgung verfolgt das Transkulturelle Zentrum ein drittes Ziel: die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte in die psychiatrische und psychotherapeutische Forschung. Bislang mangelt es in der Forschung oft an Diversität, da Sprachbarrieren häufig ein Ausschlusskriterium für die Studienteilnahme darstellen. Das Transkulturelle Zentrum setzt sich daher dafür ein, dass künftig auch Daten von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Forschung berücksichtigt werden.
Mit dem Transkulturellen Zentrum strebt das ZI eine umfassende Transformation der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung an. Kulturelle und sprachliche Diversität sollen als Stärke und Chance genutzt werden. Durch die interkulturelle Öffnung, eine angepasste Behandlung sowie die Integration in die Forschung leistet das Transkulturelle Zentrum einen wichtigen Beitrag zu einer gerechteren und inklusiveren Gesundheitsversorgung in der Psychiatrie.
Den Artikel mit ergänzenden Gesprächen mit Meryem Başak und Dr. Dimitri Hefter finden Sie im aktuellen Jahresbericht.